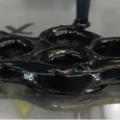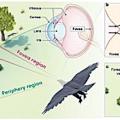Computer erkennen Stimmung ihrer Nutzer
Verfasst von Kempkens/pte am Mi, 05. Juni 2024 - 09:17Computer können dank Forschern der Universität Jyväskylä künftig erkennen, welche Laune ihr Bediener hat - ob er sich freut, depressiv ist oder verärgert. Das Modell der Wissenschaftler basiert auf der mathematischen Psychologie und ermöglicht es Computern, menschliche Emotionen zu interpretieren und zu verstehen. Dieser Fortschritt könnte die Schnittstelle zwischen Menschen und intelligenten Technologien, einschliesslich Systemen der Künstlichen Intelligenz, erheblich verbessern. Denn sie werden intuitiver und können auf die Gefühle der Nutzer eingehen.