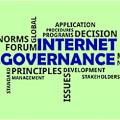In Bern fand erneut das Swiss Internet Governance Forum (Swiss IGF) statt. Seit neun Jahren wird es von einer engagierten Community unter dem Patronat des Bakom organisiert. Der nationale Ableger des Internet Governance Prozesses der Vereinten Nationen bringt diverse Stakeholder zusammen, um Digitalpolitik von KI-Regulierung und Cybersicherheit bis hin zu Nachhaltigkeit und digitalen Rechten zu diskutieren. Dieses Jahr nahmen mit über 500 Teilnehmenden off- und online so viele Personen wie noch nie in der Geschichte der Konferenz teil.
Das globale Internet Governance Forum wurde 2005 beim UNO-Weltgipfel der Informationsgesellschaft (WSISL) geschaffen. Seither haben sich spontan zahlreiche regionale und nationale Foren gebildet. Auf regionaler – d.h. gesamteuropäischer – Ebene wird der IGF-Prozess im Rahmen des EuroDIG geführt.
Das Swiss IGF steht allen Interessierten offen und die Teilnahme ist kostenlos. Es wird auf bestmögliche Inklusion gesetzt, weshalb eine Teilnahme off- und online möglich ist und die Diskussionen auch übersetzt werden. Neben einer ausgewogenen Stakeholder-Beteiligung in der Organisation, wird auch bei der Zusammensetzung der Speaker der Multi-Stakeholder-Ansatz – ein Kernelement der Internet Governance – gelebt, vom öffentlichen Sektor und der Wirtschaft hin zu Akademie und Zivilgesellschaft. Die zu diskutierenden Themen werden in einem partizipativen Bottom-up-Prozess ausgewählt, dem Call for Issues.
Ursprünglich gestartet als reine Internet Governance Konferenz hat sich das Swiss IGF in den vergangenen Jahren thematisch weiterentwickelt und bildet durch den Call for Issues Digitalisierung in ihrer thematischen Breite und gesellschaftlichen Relevanz ab. Neben häufig diskutierten Themen wie der Rolle von Daten und digitalen Grundrechten geben die Themen der einzelnen Sessions auch Rückschluss auf die Fragen, welche der Gesellschaft unter den Nägeln brennen. Auch dieses Jahr konnte wieder ein vielfältiges Programm präsentiert werden mit drei Sessions zum Thema künstliche Intelligenz: Wie wird diese international reguliert, was bedeutet das für die Schweiz und wo steht die nationale Debatte sowie die Rolle von KI in Bezug auf Desinformation und demokratische Prozesse. Ausserdem wurde das Thema Cybersicherheit, der Umgang mit Datenabflüssen sowie die Nachhaltigkeit der Digitalisierung diskutiert. Weitere Sessions setzten sich mit der Frage von Digital Skills, digitalen Rechten und der erweiterten Nutzung von Daten auseinander.
Erstmals gab das neue Format der Lightning-Talk interessierten Personen die Möglichkeit, ihre Arbeit kurz der Community zu präsentieren: von neuen Studien und den Digital-Strategien der Schweizer Verwaltung hin zum Global Digital Compact und der Schweizer Position.
Messages als Input für internationale Diskussionen
Am Swiss IGF werden zwar keine formellen Beschlüsse gefasst, doch der intensive Austausch zwischen verschiedenen Stakeholdergruppen erlaubt es, ein Stimmungsbild zu den diskutierten Themen abzuholen. Deshalb werden die Kernbotschaften der einzelnen Sessions in den "Messages from Berne" zusammengefasst, welche als Input für regionale und internationale Diskussionen dienen. Nachfolgend drei der insgesamt acht Botschaften.
Session 1: Regulierung von KI – Einsichten in den internationalen Wettlauf:
Alle Nationen, unabhängig ihres politischen Systems und ihrer Wirtschaftskraft, sollen bei internationalen Abstimmungen zur AI-Governance und Regulierung eingebunden werden. Ziel ist eine langfristige Harmonisierung der internationalen Ansätze, die den unterschiedlichen Kontexten und Anwendungsfällen von KI gerecht werden. Internationale Standardisierungen stützen diesen Prozess, auch wenn sich unterschiedliche regulatorische Umfelder etablieren. Für einen sicheren Einsatz von KI sind menschliche Kontrollstellen unabdingbar. Diese sollten kontextbezogen (Branche & Anwendungsfall) definiert werden. Die nötigen Ressourcen dafür müssen werden. Neben breiter Wissensvermittlung ist es wichtig, rasch Fachexpertise in Organisationen aufzubauen. Regulierungsbemühungen sollten sich nicht nur auf KI-Modelle und deren Anwendungen, sondern den gesamten Tech-Stack fokussieren. Eine umfassende Betrachtung aller Ebenen und Stakeholder ist notwendig, um Sicherheitsaspekte effektiv zu adressieren.
Session 2: Cybersicherheit, Datensicherheit, Datenschutz: Datenabflüsse verhindern – aber auch lernen, damit umzugehen
Public Private Partnerships sind für das Teilen von Wissen und Fähigkeiten wichtig. Behörden wie auch Unternehmen müssen über die Grenzen der eigenen Organisation hinausdenken.Zertifikate, Standards, Checklisten und gesetzliche Vorgaben wie das neue Informationssicherheitsgesetz oder das Datenschutzgesetz helfen, sinnvolle Massnahmen zu identifizieren und umzusetzen. Entsprechende Compliance hilft, Sicherheit zu erhöhen, garantiert jedoch nicht, dass eine Organisation oder ein Produkt "sicher" ist. Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist angezeigt und auch Überlegungen zu Resilienz sind notwendig. Weder Zertifikate noch das Abarbeiten von Checklisten noch eine Cyberversicherung garantiert das Ausbleiben eines Cyberangriffs. Regulierungen und Meldepflichten dienen dazu, einen Rahmen zu setzen und die Lage abschätzen zu können. Daraus können Schwerpunkte erkannt werden, um nicht zuletzt auch die Bevölkerung auf Cyberbedrohungen zu sensibilisieren und auszubilden. So wird allen ermöglicht, zur allgemeinen Cybersicherheit beizutragen.
Session 3: Regulierung von Künstlicher Intelligenz in der Schweiz:
Die Bundesverwaltung verfasst bis Ende 2024 eine interdepartementale Übersicht zu den möglichen Regulierungsansätzen zu KI für die Schweiz. Dabei wird vor dem Hintergrund internationaler Entwicklungen geprüft, welche Bereiche bereits ausreichend reguliert sind und wo Regulierungslücken bestehen. Bei der Leitfrage nach einer sektoriellen oder einer horizontalen Regulierung für KI gingen die Meinungen auseinander, wobei die Tendenz bei Detailfragen Richtung sektoriell und bei abstrakten Prinzipien zu horizontal ging. Ein direkter autonomer Nachvollzug des EU-AI Acts ins Schweizerische Recht wurde mit Verweis auf die EU-Spezifika des Gesetzes breit abgewiesen. "Sandboxing" zur Aufweichung rechtlicher Vorschriften zu Experimentierungszwecken fand zwar Anklang, könnte aber auch ein Hinweis auf überrestriktive Regeln sein. Angesprochen wurde auch der Arbeitnehmenden-Schutz, die urheberrechtlichen Herausforderungen durch KI sowie das Fehlen der technischen Umsetzungsperspektive im Diskurs.
Alle Botschaften des Swiss IGF 2024 hier!!
Weitere Infos: https://ww.igf.swiss

Der Online-Stellenmarkt für ICT Professionals