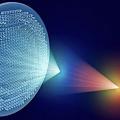Forscher der Case Western Reserve University optimieren optische Linsen mit Flüssigkristall-Metamaterialien, künstlichen Werkstoffen, die in der Natur nicht vorkommen. Darauf platzieren Giuseppe Strangi und sein Team Quarzsäulen im Nanoformat, die die Aufgabe der Lichtbrechung übernehmen. Der Vorteil dieses Arrangements im Vergleich zur Glaslinse: Letztere bricht das Licht, das durch die äußeren Bereiche fällt. Es entstehen Abbildungsfehler, die durch weitere Linsen korrigiert werden müssen, wenn das Bild optimal werden soll. Die neue Linse benötigt keine Korrektur.
Strangi begnügt sich nicht mit den quarzbestückten Metalinsen, die das Licht stets in der gleichen Art brechen. Ziel war eine Linse, die ihren Brennpunkt verändern kann, wenn äussere Kräfte wirken. Er schmuggelte in die winzigen Zwischenräume zwischen den Quarzsäulen Flüssigkristalle. Diese lassen sich thermisch, magnetisch oder elektrisch manipulieren, sodass sich die Eigenschaften der Linse ändern. Bei gläsernen Optiken sind dazu mehrere Linsen nötig, deren Abstand verändert wird. "Wir glauben, dass wir mit unserem Verfahren die Optik, wie wir sie seit dem 16. Jahrhundert kennen, revolutionieren können", sagt Strangi.
Pionier in diesem Bereich ist Federico Capasso von der Harvard University. Vor zehn Jahren begann er mit der Entwicklung von Metaoberflächen, um gläserne Linsen zu ersetzen. Er wollte vor allem medizinische Geräte wie Endoskope, mit denen Ärzte in das Innere von Menschen schauen, damit ausstatten, um sie zu verkleinern. Die Technologie wurde 2019 vom Weltwirtschaftsforum in Davos unter die Top-10 der aufstrebenden Technologien eingeordnet. Sie ist auch einsetzbar in der optischen Datenübertragung mit Lichtwellenleitern und in Sensoren.

Der Online-Stellenmarkt für ICT Professionals